5. Semester
Werbung
Wenn ihr das hier lest – erst einmal herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Physikum. Nachdem ihr das 1. Staatsexamen geschafft habt, wartet nun die Klinik auf euch. In den Fächern des 3. Studienjahrs hat man allerdings noch immer keinen Patientenkontakt. Vielmehr schlägt das 3. Studienjahr die Brücke zwischen den theoretischen Grundlagen der Vorklinik und den Fachgebieten mit direkter Patientenversorgung wie Chirurgie und Innere Medizin.
Der Artikel basiert auf meinen Erfahrungen aus dem Wintersemester 2021/2022. Meine Infos und Ratschläge sind inzwischen teilweise überholt, bieten aber trotzdem eine gute Orientierung. Bitte haltet euch primär an die aktuellen Aushänge bzw. die Infos eurer Dozenten und verlasst euch nicht einfach auf meinen Erfahrungsbericht.
QSB 1 – Epidemiologie/Statistik
Das Fach Statistik fand in einem zweiwöchigen Block statt, entweder gleich zu Anfang oder gegen Ende des Semesters. Es gab eine Vorlesungs- und eine Seminarreihe. Die Klausur am Ende der zwei Wochen war eine Open-Book-Klausur mit Freitextaufgaben. Im Prinzip durften wir alle analogen Hilfsmittel und einen Taschenrechner verwenden.
Ich habe mich anhand des Skripts und der Vorlesungsfolien vorbereitet. Da man alles nachschlagen konnte, lag der Fokus auf dem Verstehen und Anwenden der Inhalte. Wenn man die Vorlesung besucht und die Übungsaufgaben aus den Seminaren durcharbeitet, ist das auch problemlos machbar.
Für mich war es wichtig jede Formel und Tabelle während der Klausur schnell wiederzufinden, um sich in der Aufregung nicht zu verhaspeln. Also habe ich mir kleine Klebchen an die Seiten gemacht und konnte alles auf Anhieb aufschlagen.
Nach zwei Wochen Statistikunterricht konnte man die Klausur gut bestehen, auch wenn das Prüfungsformat ungewöhnlich war.
QSB 2 – Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (GTE)
Wahrscheinlich war kein anderes Fach im Leipziger Medizinstudium so gefürchtet wie GTE. Die Klausur war aus meiner Sicht die schwierigste im gesamten Studium. Wahrscheinlich wird sich das bald ändern oder geändert haben. Ich möchte hier trotzdem von dem Fach und der Klausurvorbereitung berichten, da man viele der folgenden Tipps auf andere Fächer übertragen kann.
Bei GTE stellt sich die Frage: „Wozu braucht man so ein Fach überhaupt?“ Man kann zu dem Schluss kommen, dass das Fach schlichtweg irrelevant und damit uninteressant ist. Mit dieser pragmatischen Eistellung vergibt man aber eine Chance. Die Geschichte der Medizin ermöglicht uns, die heute praktizierte „moderne Medizin“ in einen Kontext zu setzen. Es ist interessant und hilfreich zu verstehen, wie und warum sich die Medizin zu dem entwickelt hat, was sie heute ist. Dieses Hintergrundwissen kann unseren Blickwinkel auf Untersuchungstechniken, diagnostische Mittel oder Erkrankungen verändern, uns dabei helfen sie besser zu verstehen und ihnen eine andere Bedeutung beizumessen.
Die Ethik der Medizin möchte vor allem Werte vermitteln und uns eine Entscheidungshilfe an die Hand geben. Medizin besteht nicht nur aus Zahlen, Daten, Fakten und Leitlinien. Unsere Patienten sind einzigartige Individuen in einzigartigen Lebenssituationen. Die szientistische Sichtweise, wie sie an Schulen und Universitäten vermittelt wird, kann dem alleine nicht gerecht werden. Es braucht stets individuelle Entscheidungen und hier hat Ethik sehr wohl ihren Platz.
Meine Klausurvorbereitung begann direkt ab der ersten Vorlesung. Ich habe alle Vorlesungen detailliert in Notion ausgearbeitet und als Lerngrundlage genutzt. Zudem haben wir alle mit dem Lehrbuch „Grundwissen Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin“ 1 gelernt und viel gekreuzt. Wenn sich die Klausur ändert, wird wahrscheinlich auch der Stellenwert des o.g. Lehrbuches sinken, sodass ich hier keine Kaufempfehlung aussprechen möchte.
GTE war ein Fach, in das man sich wirklich reinknien musste. Im 5. Semester habe ich mehr für die GTE-Klausur gelernt als für jede andere Prüfung. Zugleich war die Vorbereitung auch eine spannende Abwechslung zu den anderen Fächern.
QSB 11 – Bildgebende Verfahren
Hinter QSB 11 verbergen sich die Fächer Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Der QSB 11 ist durchaus abwechslungsreich und wird euch bis ins 8. Semester begleiten. Im 5. Semester hatten wir nur eine Woche lang Vorlesungen und einen Kurs zu dem Thema.
Die Abschlussklausur findet zwar erst im 8. Semester statt, doch auch die Veranstaltungen aus den vorherigen Semestern sind grundsätzlich prüfungsrelevant. Gute Aufzeichnungen schaden definitiv nicht.
allgemeine Pathologie
Zur Klausurvorbereitung habe ich vor allem das digitale Karteikartensystem Anki genutzt:
- Die Vorlesungen besuchen und die Infos direkt in digitale Karteikarten verpacken.
- Die Karteikarten lernen und wiederholen. Dabei gilt: früh anfangen und täglich dranbleiben. Der Algorithmus von Anki erledigt den Rest.
- Kreuzen. Kreuzen. Kreuzen. Das sollte inzwischen selbstverständlich sein.
Diese Strategie hat dank des besagten Algorithmus großes Potenzial, bringt jedoch auch Nachteile mit sich:
- Reguläre Notizprogramme wie Notion erlauben es Informationen schnell zu strukturieren. In Karteikartensystemen liegen die Infos nebeneinander wie einzelne Sandkörnchen an einem Strand.
- Lösung 1: Man erstellt für jede Vorlesung bzw. jedes Thema ein eigenes Kartendeck. So gibt es zumindest eine vage Struktur und man kann die Karten zu einem Thema gesammelt durchgehen.
- Lösung 2: Mindmaps können helfen die Vorlesungen gedanklich zu strukturieren. Auf diese Weise schafft ihr ein Grundgerüst, an das ihr die einzelnen Informationen anknüpfen könnt.
- Vielen Studenten fällt es durch das hohe Tempo in Vorlesungen schwer direkt Karteikarten zu erstellen, anstatt einfach mitzuschreiben.
- Lösung: Man schreibt während der Vorlesung digital auf den Folien mit und erstellt später daraus Karteikarten. Das bringt allerdings einen zusätzlichen zeitfressenden Arbeitsschritt mit sich.
Ob man lieber mit Karteikartensystemen wie Anki, Notizprogrammen wie Notion oder nur den Vorlesungsfolien lernt, muss jeder für sich herausfinden. Es gibt viele gute Lernmethoden – und Anki ist definitiv einen Versuch wert.
Histopathologie
Pathologie ist das Pendant zur Anatomie in der Klinik. Man könnte sagen, die Anatomie befasst sich mit dem (gesunden) menschlichen Körper – die Pathologie befasst sich mit den Erkrankungen des menschlichen Körpers. Beide Fächer haben eine Vorlesungsreihe zur Makroskopie und einen Kurs zur Mikroskopie. Die Pathologie begleitet euch durch die gesamte Klinik und legt Grundlagen an die andere Fächer später anknüpfen.
Die Histopathologie ist ähnlich aufgebaut, wie die Histologie im 1. Studienjahr. Wir hatten einen Kurs, in dem die Präparate anhand des Skripts durchgesprochen wurden. Am Ende wurde alles in einer separaten Klausur abgeprüft.
Ich habe das Skript, meine Kursnotizen und das virtuelle Mikroskop der Uni Leipzig genutzt, um wieder eine Anki-Kartei zu erstellen. Histopathologie gehörte zu den schwereren Klausuren des 5. Semesters, aber mit der oben beschriebenen Anki-Methode bin ich gut durchgekommen.
Für die passionierten Anki-Nutzer unter euch möchte ich kurz meinen Kartentyp für Histopathologie erklären:
Der Kartentyp basiert auf der Vorlage: „Einfach (beide Richtungen)“ bzw. „Basic (and reversed) card“ und besitzt vier Eingabefelder:
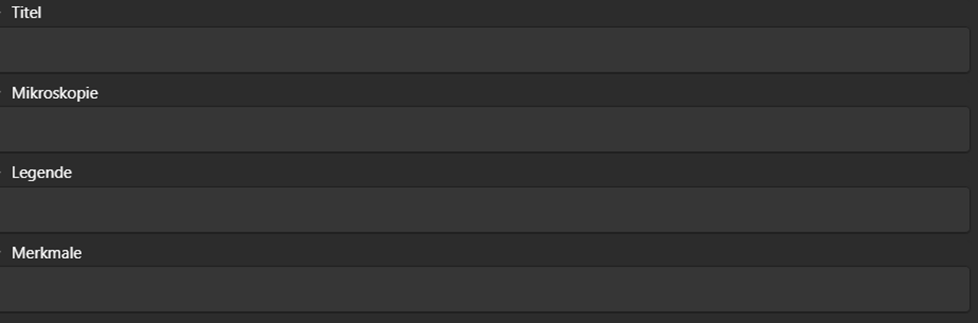
Benutzeroberfläche von Anki2
- Titel: beinhaltet Krankheitsbild, Organ, Färbung und einen Hinweis auf die abgefragten Merkmale
zum Beispiel: Akutes Atemnotssyndrom (Lunge, HE) [Definition; Pathogenese; 2 Phasen; 2 Histo-Merkmale] - Mikroskopie: Präparatbilder in denen die Strukturen mit Zahlen beschriftet sind
- Legende: Auflistung der Strukturen zu den Zahlen
- Merkmale: ein stichpunktartiges Exzerpt aus dem Skript
Beim Erstellen der Karte generiert Anki dank der Vorlage zwei Versionen. Die habe ich wie folgt angepasst:
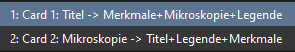
Benutzeroberfläche von Anki2
Auf der ersten Karte sieht man nur den Titel und soll anhand der Hinweise in Klammern die Informationen unter Merkmale nennen. Bei der zweiten Variante werden nur die Bilder gezeigt und man muss das Präparat erkennen, sowie die gezeigten Strukturen benennen.
Klinische Chemie
Die Klinische Chemie, auch KliChi oder Labormedizin genannt, schreckt anfangs viele Studenten ab. Auf den ersten Blick mag es langweilig erscheinen auf verschiedenen Laborparametern herumzuhacken, aber KliChi ist viel mehr als das. In diesem Fach lernt ihr viele Krankheitsbilder und andere Grundlagen kennen, welche später in Pharmakologie, Innerer Medizin und dem Berufsalltag hochrelevant sind.
Unsere Dozenten waren überaus engagiert und man konnte vieles mitnehmen, wenn man sich auf das Fach einließ. Neben den Vorlesungen gab es auch Praktika und Seminare – dank der Pandemie allesamt digital. Für die Klausurvorbereitung habe ich die Vorlesungen in Notion ausgearbeitet, wiederholt und viel gekreuzt.
Untersuchungskurs
Der U-Kurs findet am Ende des Semesters nach den anderen Fächern statt. Hier sollt ihr Anamnese und klinische Untersuchung lernen. Genau wie der Gesprächsführungskurs vermittelt auch der U-Kurs ärztliche Kernkompetenzen, die jeder von uns beherrschen sollte egal welche Fachrichtung man wählt.
Begleitend zu den praktischen Übungsterminen gab es mehrere Vorlesungsreihen, in denen die verschiedenen Fachrichtungen die Untersuchungsmethoden erklärten. Die Prüfung fand erst kurz vor Beginn des 6. Semesters statt, sodass man in den Semesterferien genügend Zeit zur Vorbereitung hatte.
Die OSCE-Prüfung (1. Teil) war i.d.R. mündlich-praktischer Natur. In der Vorbereitung hat mir besonders das U-Kurs-Heft weitergeholfen. Es beinhaltet eine kurze, recht vollständige Zusammenfassung der verschiedenen Untersuchungstechniken – perfekt zum Lernen. Die Notizen aus Vorlesungen und Übungsterminen waren eine gute Ergänzung.
Zum Wiederholen und praktischen Üben kann ich euch die fakultativen Kopfkurse der LernKlinik ans Herz legen. Darüber hinaus könnt ihr auch an Freunden bzw. Kommilitonen hervorragend gegenseitig üben.
Tipps für die Klinik
Als Medizinstudenten haben wir die Chance auch auf eigene Faust in verschiedene Fachbereiche reinzuschnuppern. Für so etwas gibt es natürlich auch Famulaturen. Aber wenn ihr so seid wie ich, dann reichen vier Famulaturen nicht aus, um alle interessanten Fachbereiche abzudecken. Wenn euch ein Fach aus den Vorlesungen (oder später UaKs) anspricht, dann könnt ihr euch in den Semesterferien einige Tage nehmen und in der Fachrichtung hospitieren.
Lehrveranstaltungen können nicht vermitteln, wie der Arbeitsalltag in einem Fachbereich aussieht. Durch kleine Hospitationen erlebt ihr genau den Alltag, der euch später einmal erwartet. Die meisten Ärzte freuen sich, wenn jemand Interesse an ihrem Fach zeigt und gehen gerne auf Fragen ein.
Natürlich möchte jeder von uns auch mal seine Ruhe haben und an etwas anderes als Medizin denken. Kleine Einblicke durch Hospitationen sind jetzt im Studium noch unkompliziert möglich – ob ihr sie mitnehmen wollt, liegt natürlich bei euch.
Zum Abschluss noch ein praktischer Hinweis: Ab dem 5. Semester bekommt man Hefte zur Anwesenheitsdokumentation. Diese Hefte muss man später vervollständigt abgeben, um zum 2. Staatsexamen zugelassen zu werden. Passt auf diese Hefte sehr gut auf und macht regelmäßig digitale Backups. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein, aber ich habe in den drei Jahren Klinik so einiges erlebt…
Viel Freude und Neugier für euren Start in die Klinik!
Frédéric
Literaturverzeichnis:
1 Riha, Ortrun: Grundwissen Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin, 2. Aufl., Verlag Hans Huber, 2013.
2 Ich mache mir Design und Funktionalität aus den Screenshots nicht zu eigen. Sie dienen nur der Veranschaulichung und Vorstellung der Open Source Software Anki, welche von Damien Elmes, Ankitects Pty Ltd. geschrieben wurde.